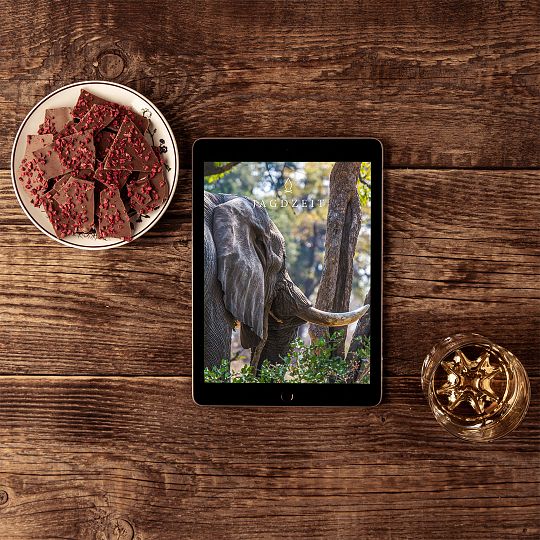Ein Jagdführer, zwei Gäste. Ein einfaches Zeltcamp. Puristisch, reduziert aufs Wesentliche, ohne weiteres Personal. Pirschgänge – im Wortsinne – auf der Suche nach Wildtieren. Jagen wie vor langer Zeit, da heute ja fast jede Safari mit Luxus verbunden ist. Nachfolgend also das Gegenmodell. Eine wertvolle Erfahrung!
Text & Fotos Paul Kretschmar
„Willst Du die Regierung stürzen?“, fragt der Snackbarverkäufer am Flughafen in ironischem Ton – mit Anspielung auf meine Tarnjacke – und lacht in tiefem Bass über seinen Scherz.
Die beigen Pirschhosen mit Knieschonern, das olivgrüne Jagdhemd und die Tarnjacke trage ich auf diesem Flug mit Bedacht gleich am Mann, Glas und Gehörschutz sind im Handgepäck. Leidgeplagt, wie ich bin, denn mein Koffer war vergangenes Jahr auf einem Lufthansa-Flug verschwunden und ist nie wieder aufgetaucht. Auch auf eine Entschädigung warte ich bisher vergeblich, der Kundenservice stellt sich tot. So habe ich meine Lektion gelernt und trage alles für die Pirsch Nötige direkt bei mir.
Ich freue mich, diese Reise ins südliche Afrika nach vier COVID-bedingten Umbuchungen nun endlich antreten zu können. Zwischenstopp in Frankfurt, bevor es weitergeht, quer über Afrika, vorbei an den Mambova Rapids, dem Chobe-Nationalpark in Richtung der namibischen Hauptstadt Windhuk.
Als nach zehn Stunden Flug endlich das Kommando „all doors in park“ erschallt und ich wenig später über die Gangway hinab auf das Rollfeld trete, empfangen mich Palmen, Sonne und die trockene Luft des Khomas-Hochlandes. Ich sauge ihn tief in mich ein, den Geruch Namibias.
Jagdfreund Gabriel empfängt mich freudig am Ankunfts-Gate, er ist bereits seit einigen Wochen hier, was sich auch optisch zeigt. Gebräunte Haut und wilder Bartwuchs, beiges T-Shir...